– Gedanken zu Ethnographie und Direct Cinema
Wenn Menschen sich treffen und Dinge tun, dann ist das nicht völlig willkürlich. Menschliches Handeln ist geordnet, nach welchem System und welcher Logik auch immer. Manchmal kommen wir in eine Situation und verstehen sofort, was dort passiert, warum und was man tun muss, um mitzumachen. Manchmal allerdings… weniger.
Nichtwissen als Grundhaltung der Teilnehmenden Beobachtung
Qualitative Sozialforschung will, ganz grob gesagt, verstehen, was die Menschen tun und warum sie tun, was sie tun. Weil Menschen zum Glück einigermaßen vernunftsbegabte Wesen sind, die darüber hinaus sogar sprechen können, kann man sie einfach fragen. Interviews und die Auswertung von Textdokumenten sind darum auch eine der Hauptinformationsquellen der qualitativen Forschung.
Nun hat sich aber herausgestellt, dass die Menschen manchmal selbst nicht so ganz genau wissen, warum sie tun, was sie tun. Manchmal wollen sie es nicht zugeben. Manchmal fehlen ihnen die richtigen Worte. Manchmal erscheinen ihnen die Dinge zu banal, um sie überhaupt zu erwähnen. Manchmal irren sie sich schlicht und ergreifend. (Natürlich ist das nur die eine Seite der Probleme: Oft genug stellen die Forschenden die falschen Fragen. Oft genug hören sie nicht richtig zu. Oft genug fragen sie die falschen Leute. Oft genug bemerken sie Widersprüche nicht, oder erst viel später.) In der doch recht künstlichen Situation des Interviews wirken auf einmal andere Dinge wichtig als im Alltag, das Gespräch entwickelt eine bestimmte Dynamik, bestimmte Themen kommen auf und andere eben nicht. Klar, gute Interviewer kennen Techniken, um das zu vermeiden, aber es bleibt dabei: Ein Gespräch über eine Erfahrung ist nicht das gleiche wie die Erfahrung selbst.
Um an die Erfahrung selbst heranzukommen, oder sie zumindest nachvollziehen zu können, begeben sich qualitativ Forschende ‚ins Feld‘, also dorthin, wo die Menschen sind und das tun, was sie eben tun. In der Teilnehmenden Beobachtung, der Königsdisziplin der Ethnologie, nimmt man an den Praktiken teil und beobachtet, dokumentiert alles, was man sieht, und bemüht sich, möglichst wenig auf das Geschehen einzuwirken. Man lässt die Leute einfach machen. Natürlich verändert es die Situation, wenn jemand dabei ist, der nicht genuiner Teil der Gruppe ist und der möglicherweise sogar Notizen macht. Aber gute teilnehmende Beobachter sind eben auch gut darin, möglichst wenig zu stören.
Oft versteht man – zumindest am Anfang – nicht so ganz genau, was die Leute tun. Und erst recht nicht, warum. Wer als nicht-Katholik schonmal einen katholischen Gottesdienst besucht hat, kennt das Gefühl: Alle wissen, wann was zu tun ist und sie tun es ohne Absprache. Ständig laufen Männer in goldenen oder zumindest reich bestickten, bodenlangen Gewändern im Altarraum herum, manchmal werden sie von Kindern in langen Gewändern begleitet (wozu?), manchmal nicht (warum nicht?). Um einen herum murmeln die Leute unverständliche Silben in offenbar festgelegtem Rhythmus (woher kennen die alle den Text? Was bedeutet er? Verstehen die selbst, was sie da reden? Ist das wichtig?). Auf einmal tippen sich alle gleichzeitig mit den Händen auf die Schultern, rechts-links-Stirn-Bauch (oder links-rechts? Was, wenn man es falsch macht?), dann malen sie sich kleine Kreuze auf Stirn, Mund und Brust. Jemand liest Fürbitten (wer ist das? Wer bestimmt, wer vorlesen darf? Wer bestimmt, wofür gebetet wird?). Wie auf Kommando stehen alle gleichzeitig auf, setzen sich wieder hin, stehen auf, knieen, stehen wieder, knieen wieder (aber manche bleiben stehen – warum?) dann strömen alle nach vorne (soll man mitströmen? Wie stört man weniger – wenn man sitzenbleibt und den Fluss aufhält oder wenn man mitgeht und nicht weiß wie man die Hände hält? Sagt der Pfarrer was, und was, und antwortet man, und wie? Reicht lächeln und nicken oder schaut man lieber ernst und andächtig?).
Diese Anfangsirritation ist für die Teilnehmende Beobachtung von unschätzbarem Wert. Vieles von dem, was einem auf Anhieb fremd und rätselhaft vorkommt, wird man mit der Zeit herausfinden. Man wird wissen, was die Leute murmeln, dass diejenigen mit den künstlichen Kniegelenken stehen bleiben, wer bei der Predigt einschläft und worüber sich die Damen danach auf dem Kirchhof unterhalten. Und irgendwann wird man sich hinsetzen und seine Notizen auswerten, wird ein paar Theorien über Menschen und Gesellschaft danebenlegen, wird Literatur sichten und herausfinden, was Experten zu dem Thema sagen, über alles nachdenken und irgendwann verstehen, was die Katholiken da tun und warum. Im Idealfall schreibt man seine Erkenntnisse dann auch noch auf, damit auch andere ein bisschen was verstehen.
Beobachten im Dokumentarfilm „Soldaten des Lichts“
Der Ansatz des Direct Cinema im Dokumentarfilm geht ähnlich vor. Die Idee ist, mit kleiner Kamera und wenig Personal – häufig nur zwei Personen, nämlich Kamera und Ton – dabei zu sein und so soziale Situationen beinahe authentisch einzufangen. Beinahe authentisch, weil: Die Kamera ist nun mal da. Und das Mikrofon auch. Und die Menschen, die beides halten. Auch der Blick der Kamera ist gelenkt. Aber dennoch, das Setting wird von den Protagonisten bestimmt, die Kamera passt sich an.
„Soldaten des Lichts“
(en.: „Soldiers of Light“)
Dokumentarfilm
Deutschland, 2025
108 min.
Johannes Büttner & Julian Vogel
Wood Water Films, patatino
 Bild: Wood Water Films / Soldaten des Lichts
Bild: Wood Water Films / Soldaten des LichtsDer Film „Soldaten des Lichts“ fühlt sich an vielen Stellen an wie eine teilnehmende Beobachtung: Man steht in einer Küche und schaut zu, wie Menschen Smoothies aus grünen Blättern herstellen. Wildkräuter, erfährt man später, die sie jeden Tag frisch sammeln. Warum tun sie das? Glauben sie an die Heilkraft der Kräuter? Oder machen sie mit, weil sie Teil der Gruppe sein wollen? Wie sehen sie sich selbst, was treibt sie an, womit hadern sie? Immer wieder geht es um Heilung oder vielmehr um das Versprechen auf Heilung, durch Energie, durch Kräuter, durch Ernährung, durch die Entscheidung gegen die Krankheit. Glauben die das wirklich? Wer glaubt es – die, die Heilung versprechen oder die, die Heilung suchen? Man weiß es nicht.
Man sitzt in einem Stuhlkreis und schaut zu, wie Menschen ein Rollenspiel machen, es geht irgendwie um die Bewältigung der Verletzungen im Zuge der Coronapolitik. Jemand geht in die Rolle der Bundesrepublik, jemand in die Rolle der Bevölkerung. Die Bundesrepublik entschuldigt sich für ihr Versagen. Was sind das für Menschen? Was denken sie? Machen sie das öfter? Woher haben sie die Anleitung, die Rollenbeschreibungen – gibt es überhaupt welche? Oder ist das improvisiert? Es geht um Kritik am politischen System, es geht um das Königreich Deutschland, um Kritik, um Freiheit, und es geht darum, keine Steuern zu zahlen. Was ist die Gewichtung? Was davon bleibt im kleinen Kreis, gibt es Aggressionspotenzial, wo, warum? Man weiß es nicht.
Man sitzt auf dem Beifahrersitz und hört jemandem zu, David, immerhin dem Protagonisten der Doku, wie er darüber schwadroniert, dass die Menschen zu wenig lesen, oder zu viel, oder das falsche, ich habe den Faden verloren, denn David redet schnell und schnodderig. Woher hat er diese Ideen? Welche Bücher hat er gelesen? Welche Artikel? Wer hat ihm davon erzählt? Warum findet er es einleuchtend? Immer wieder geht es auch um Gott, oder das Heilige, oder das Beten. In Davids Café hängen Bibelverse und Verse aus dem Koran an der Wand. Ein Mitglied der Gruppe erzählt von seiner Morgenroutine mit stundenlanger Meditation. Was glauben diese Leute? Welche Rolle spielt ihre Spiritualität in der ganzen Sache? Man weiß es nicht.
Die Aufnahmen sind über einen sehr langen Zeitraum entstanden. Über zwei Jahre lang haben die Filmemacher Julian Vogel und Johannes Blütner David und seine Gruppe begleitet und Material gesammelt. Und das merkt man. Was hier präsentiert wird, sind keine schnellen hin-und-weg-Mitschnitte voller oberflächlicher Symbolik, sondern dichte Einblicke, Schlüsselszenen, in denen wirklich etwas verhandelt wird. Zum Beispiel, als die Gruppe umzieht und ihr neues Haus bezieht, sich in den neuen Räumen einrichtet. Als sie darüber sprechen, dass zwei Mitglieder die Gruppe verlassen haben und wie sie als Gruppe damit umgehen. Oder als David, selbst Influencer, einen anderen Influencer empfängt und sich im Moment des Zusammentreffens sein Tonfall und seine Haltung ganz subtil ändern und man auf einmal den Unterschied bemerkt zwischen dem Menschen und seiner Social Media-Persona.
Zugang und Wissensdurst
In der Feldforschung würde ich hin und wieder nachfragen. Ich würde mit den Leuten ins Gespräch kommen und mir Dinge erklären lassen. Ich würde sagen: „Ist das ein Vers aus dem Koran?“ und wäre gespannt auf die Antwort. Ich würde sie ermuntern, mir von ihren Erfahrungen zu erzählen, mir ihre Deutungen anhören. Manchmal würde ich dagegenhalten und hören, wie sie damit umgehen. Mit manchen würde ich ein Interview führen, offiziell und mit Aufnahmegerät, mit anderen würde ich zwischendrin ein Pläuschchen halten, ganz informell. Ich würde Informationen sammeln, die über das, was man sieht, hinausgeht, die mir helfen, die Strukturen und Logiken zu verstehen, die die Alltagshandlungen antreiben.
„Soldaten des Lichts“ verzichtet in großen Teilen auf Interviews und vollkommen auf Kommentare und Einordnungen. Die Filmemacher wollen, ganz im Sinne des Direct Cinema, dass das Material selbst wirkt. In der Diskussion des Films auf dem Dok.fest München (hier die Aufzeichnung des Streams) erklären die Filmemacher, dass gerade diese beobachtende, rein darstellende und nicht kommentierende Herangehensweise dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt filmen durften, dass die Probanden dem Dreh zugestimmt und ihre Anwesenheit akzeptiert haben. Gleichzeitig, das verheimlichen sie nicht, werden durch Schnitt und Montage die Aufmerksamkeit gelenkt und Zusammenhänge hergestellt. Sie berichten von dem Dilemma, dass sie die Gruppe und auch die Szene, in der sie sich bewegt, darstellen wollten ohne ihnen aber eine Plattform zu bieten, ihre eigenen Inhalte zu verbreiten. Die Filmemacher entschieden sich daher für eine industrielle Asthetik, „so wie man halt eine Fabrik filmen würde“. Auch das ist nicht zufällig, denn im Grunde, so die Filmemacher, sind wir Zeugen einer gigantischen Wertschöpfungsmaschinerie. Es ist durchaus möglich, dass es den Protagonisten um Wahrheit geht, um Erkenntnis oder um Heilung. Es ist aber ganz sicher, dass es ihnen um Geld geht – und dass sie mit ihren Mittelchen und deren Inszenierung ziemlich gut verdienen. Der Fokus liegt dadurch auf dem System, auf den Gesamtzusammenhängen, nicht auf den persönlichen Schicksalen und Beweggründen der einzelnen Personen.
Gebrochen wird diese rein beobachtende Haltung im Kontakt mit Timo, einem psychisch kranken jungen Mann, der in Davids Methoden Heilung sucht. Im Gespräch mit Timo brachen sie zum ersten Mal ihre rein beobachtende Haltung, sagen die Filmemacher, und auch das sieht man im Film: Die Darstellung Timos ist intensiver, unmittelbarer, konfrontativer. Timo schaut direkt in die Kamera, wenn er antwortet. Protagonist und Kamera treten in Dialog. Timo muss sich mit Fragen auseinandersetzen, er muss antworten, er muss das in Worte fassen, was er denkt und fühlt – oder daran scheitern. Schweigen ist ein entscheidender Bestandteil seiner Antworten.
Auch hier bleibt vieles unbeantwortet, vieles im Bereich des Nichtwissens. Aber es ist eine andere Form des Nichtwissens: Auf die Frage, ob Heilung möglich ist, wie Hoffnung aussehen kann wenn man ringsumher von dunklen Mächten umgeben ist, wie selbstbestimmtes Leben aussehen kann, wenn Krankheit alle Entscheidungen trübt, gibt es keine Antworten. Das Nichtwissen in diesem Fall ist ein existenzielles, eines, dass nur durch Schweigen beantwortet werden kann. Auf die Fragen hingegen, welche Bedeutung die Bibel- und Koranverse an der Wand des Rohkostcafés für die Betreiber haben oder wer sich das Rollenspiel ausgedacht hat und wer es verbreitet, gibt es Antworten – und die Antworten sind da, vor Ort, bei den Protagonisten des Films. Man müsste sie halt fragen, dann würde sich das Nichtwissen in Wissen verwandeln. Und weiteres, immer weiteres Nichtwissen nach sich ziehen.
„Soldaten des Lichts“ lässt mich also einigermaßen ratlos zurück. Ich habe einen Einblick bekommen in eine Szene, die mir sehr fremd ist und in der ich vieles nicht verstehe. Und als nächstes muss ich das tun, was auch in der Feldforschung der nächste Schritt wäre: Ich muss Literatur suchen und Informationen sammeln, zu den Reichsbürgern, zu deren Umgebung, zu ihren religiösen Ansichten. Ich muss herausfinden, was Experten zu dem Thema sagen, muss deren Meinungen und Standpunkte gegeneinander abwägen, muss weiteres Material sichten, bis ich zum Kern vorstoße, bis ich dahin komme, wo ich eigentlich hinwill: Dass ich verstehe, was diese Leute tun und warum.
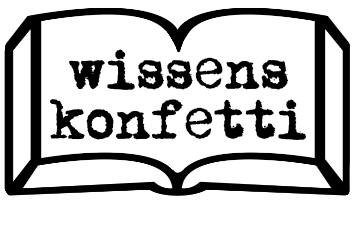




Schreibe einen Kommentar